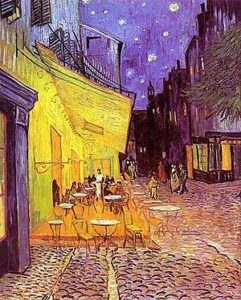Michael Hartmann, Kranzgeld und ASV-Trainingsanzüge
In die seltene Rubrik „Nachrichten, die ich nicht verstehe“, ordnete ich am dritten Juli unwillig die Meldung ein, beim SPD-Bundestags-Abgeordneten Michael Hartmann sei nach einer Hausdurchsuchung kein Crystal Meth gefunden. Sie liest sich wie eine Fake-Nachricht. „Hausdurchsuchung in Kindertagesstätte: Keine chemischen Kampfstoffe gefunden.“ oder eine Nicht-Nachricht: „Angela Merkel schon wieder nicht schwarzgefahren.“
Die Hartmann-Meldungen sind lang, die Hartmann-Meldungen sind breit, warum auch nicht, der Leser hat Zeit, möchte ich einen alten Klospruch abwandeln; aber trotz Länge und Breite erfährt der willige Medienrezipient nicht, warum man sich von einer Wohnungsdurchsuchung bei SPD-Bundestags-Abgeordneten verspricht, Crystal Meth zu finden? War Hartmanns Haut durch die mit dem Konsum dieser Droge einhergehenen Talgdrüsenentzündung auffallend picklig geworden? Hat man bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert und vermutet nun, dass er dem Beispiel des Antihelden Walter White folgen und diese Droge zuhause produzieren würde, um für die Nachkommen vorzusorgen?
Ausgerechnet Michael Hartmann, der für einen harten Kurs gegenüber selbst weichen Drogen eintritt, wie man erfährt, wenn man gugelt, um etwas über einen Abgeordneten zu erfahren, von dem man noch nie etwas gehört hat. Jetzt hat Michael Hartmann seine Warholschen fifteen minutes of fame, aber nicht durch etwas Spektakuläres wie ein Crystal Meth Labor, sondern durch das Nichtvorhandensein eines solchen. Schwer zu sagen, welche Art von Ruhm einem da lieber wäre.
Hartmann ist, wie man lesen muss, auch Mitglied des Stiftungsrats des Hohen Doms zu Mainz, einem derart alten Dom, dass sich niemand mehr erinnern kann, wann er gebaut wurde und dessen neun Glocken nur dann gleichzeitig läuten, wenn katholische Mega-Events wie Pontifikalämter und Hochfeste anstehen. Bei Pontifikalrequien hingegen läuten die ersten acht Glocken, bei Pontifkalvespern die Glocken 1, 3, 5, 6, 7 und 8.
Vermutlich werden sich außer mir viele Nicht-Katholiken und eventuell sogar eine ganze Reihe Katholiken fragen, was denn ein Pontifikalamt sei, wem es dient, ob man es essen kann und ob man seine Straßenschuhe anbehalten darf. Ich muss erfahren, dass dieser Begriff in der katholischen Kirche eine Heilige Messe bezeichnet, der ein Priester vorsteht, der zum Tragen der Pontifikalien berechtigt ist. Vielen Dank für diese Definition, liebe Wikipedianer. Sie erinnert mich an die Tautologien mathematischer Definitionen, die mich in meiner Teenagerzeit, von der Wahnvorstellung, einmal Mathematiker zu werden, kurierten, etwa: „Ein Vektor ist ein Element eines Vektorraums, das zu anderen Vektoren addiert und mit Zahlen, die als Skalare bezeichnet werden, multipliziert werden kann.“
Aber ich bin nicht faul und binge auch noch „Pontifikalienträger“. Dieser darf, im Gegensatz zu uns gewöhnlichen Sterblichen, die keine Pontifikalien tragen, zum Beispiel Jungfrauen weihen, die geweiht werden, weil sie Jungfrauen bleiben, und zwar nicht weil sie keinen abgekriegt haben, sondern weil sie ihre Jungfräulichkeit der Kirche gewidmet haben.
Die Jungfräulichkeit hat bekanntlich in Deutschland im Laufe der letzten 1.000 Jahre immer mehr an sozialer Relevanz verloren, und das sollte man begrüßen, wenn nicht sogar in unregelmäßigen Abständen zelebrieren. Einen Meilenstein der lobenswerten Jungfräulichkeitsprofanisierung setzte die rotgrüne Koalition unter Gerhard Schröder. Eigentlich kann und sollte man die Täter und Mitläufer dieser Bande für all das politische Übel, das sie angerichtet hat, immer wieder schelten und sie scheeler Blicke würdigen, wenn sie sich einem auf Sichtweite nähern. Doch bei aller Scheel-Blick-Würdigung darf man nicht vergessen, dass erst diese Regierung es im Jahr 1998 fertiggebracht hat, den Paragraph 1300 des BGB zu streichen, nach welchem Männern, die ihre Verlobte deflorierten, sie dann aber nicht heirateten, die Zahlung eines sogenannten Kranzgeldes drohte. Wie, so frage ich mich, lief in einem solchen Prozess eigentlich die Beweisführung, wenn etwa der Deflorierer seine Beteiligung an der Hymenzerstörung abstritt und seiner Widersacherin unterstellte, die Deflorierung unter Zuhilfenahme eines Massagestabes, eines Mittelfingers oder einer handelsüblichen Gurke selbst vorgenommen zu haben?
In Sachen sexueller Revolution war ja die DDR dem Westen oft voraus. Der laxe Umgang in Sachen Nudismus, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und Homosexualität sowie die Freiheit der Frauen, ihren Gatten nicht um Erlaubnis fragen zu müssen, wenn sie eine Erwerbsarbeit aufnehmen wollten, können als Beispiele ebenso herhalten wie der Umstand, dass der Kranzgeld-Paragraph bereits 1957 gestrichen wurde.
Ein ereignisreiches Jahr für den ersten Arbeiter- und Bauernstaat. (Ich habe mich übrigens immer wieder gefragt, was der entscheidende Unterschied zwischen einem Arbeiterstaat und einem Bauernstaat sei, bzw. zu welchen Anteilen die beiden Komponenten Arbeiter und Bauer die DDR zu einem Arbeiter- und Bauernstaat werden ließen. Ist das wie bei Nuss-Nougat-Creme? Die Nüsse sind die Hauptzutat, und dann erst das Nougat? Die ikonografische Glorifizierung des an der Maschine mit groben Fäusten werkelnden Proleten, der auch am 1. Mai stolz seine Stahlgießerschürze trägt, und dagegen das eher Peinlich-Berührtsein vor dem Auftreten eines Schweinestallbauern spricht für diese Reihenfolge. Aber auch in der Nuss-Nougat-Creme ist der Hauptanteil eigentlich Zucker, so wie im Politbüro dann auch die Bürokraten das Heft in der Hand hielten. Der einzige Bauer war eigentlich der sich als Dachdecker ausgebende Honecker. Exkurs Ende.)
Nicht nur wurde 1957 der Kranzgeldparagraph in der DDR abgeschafft, der Osten schlug der BRD eine Konföderation vor, und am 28. April wurde der Deutsche Turn- und Sportbund gegründet, der in 17 Bezirks-Unterorganisationen untergliedert war, obwohl die DDR eigentlich nur 15 Bezirke hatte. Die restlichen beiden waren der Stasi-eigene Club Dynamo und der Armee-Sportverein dessen ekelhaft-braune Trainingsjacken uns noch heute auf der Straße begrüßen, wenn sich hirnlose Hipster dieses Kleidungsstück, welches einst in der Freizeit überambitionierten NVA-Majoren oder resignierten Sportlehrern vorbehalten war, überziehen, und dessen extreme Hässlichkeit sich geschmeidig in die ansonstene Uneleganz des gemeinen Hipsters einfügt, dessen Anziehsachen-Beschaffung folgenden sich Prinzipien unterwirft:
– Farben müssen sich möglichst beißen und das Ugliest oft he last 100 years versammeln, etwa Neongrün, Stuhlgangsbraun und Rentnerbeige.
– Jacken, Hosen, Taschen alles drei Nummern zu klein, und mindestens so, dass man sich nicht mehr bequem darin bewegen kann.
– Alles, was man der Körper selbst produziert oder man am Körper manipulieren kann – Haare, Fingernägel, Bart, Tätowierungen und Ohrlöcher – so entsetzlich groß, dass Anfassen sich von selbst verbietet.
Ein Ohrloch zu einem Riesen-Fleischtunnel auszuweiten, bedarf einer Menge Geduld, da man pro Monat immer nur ein bis zwei Millimeter erweitern darf. Wenn ich einen Mann mit Kleinstfleischtunnel erblicke, möchte ich ihm zurufen: „Halte ein! Du wirst das Ausmaß des Fremdschämens, das deine Kinder beim Erreichen der Pubertät einst ohnehin in deiner Gegenwart verspüren werden, verachtfachen. Und wenn dir das als Argument nicht genügt, so sei dir gesagt, dass sich die unangenehme Geruchsbildung der sich im Ohrloch bildenden Talgdrüsen mit jedem Millimeter Durchmesser verschärft und, wenn man einschlägigen Berichten Glauben schenken darf, sehr an Untenrum erinnert. Verklebte Talgdrüsen und damit einhergehender Geruch – ein Problem, das wir notabene auch bei Crystal-Meth-Konsumenten beobachten können. Brachte Hartmann die Polizisten vielleicht durch fortwährende Müffelei auf seine Spur?
***
467. Nacht
Zu ihrem Unglück schwimmt einer der Seeleute zu ihrer Planke und bedrängt sie:
„Bei Allah, schon als du noch auf dem Schiffe warst, gelüstete mich nach dir; jetzt aber, wo ich bei dir bin, lass mich meinen Willen an dir tun, sonst werfe ich dich allhier ins Meer.“
Schließlich wirft er nicht sie, sondern das Kind ins Meer. Auf ein Stoßgebet hin, erscheint ein Ungeheuer, das ihn von der Planke mitreißt.
Nach einem Tag trifft sie auf ein Schiff, das sie aufnimmt und dessen Besatzung auch das Kind vom Rücken des Ungeheuers geborgen hat.
Der Erzähler berichtet, er habe der Frau, nachdem sie ihre Geschichte erzählt hatte, Geld geben wollen.
Aber sie rief: „Weg damit, du Tor! Sagte ich dir nicht, wie Er gnädig spendet und in seiner Huld alles zum Guten wendet? Soll ich Wohltaten von jemand anders annehmen als von Ihm?“
Sehr eigenwillig. Wie erhält sie Nahrung, wenn nicht von Menschen oder eigener Arbeit? Gott als eine Art Weihnachtsmann?
*
Die Geschichte von dem frommen Negersklaven
Mâlik ibn Dinâr berichtet, in Basra sei einst der Regen ausgeblieben, und er und seine Gefährten gingen zu einer Gebetskapelle, wo sie einen Schwarzen mit seltsamen Körperlichen Merkmalen beten sehen. Er
betete zwei Rak’as, und beide Male war seine Haltung beim Stehen und Verneigen genau die gleiche.
Ist das erstrebenswert im Islam?
Nachdem der Schwarze Gott „bei deiner Liebe zu mir“ um Regen gebeten hat, fängt es an zu strömen
wie aus offenen Wasserschläuchen.
*
468. Nacht
Mâlik ibn Dinâr wirft dem Schwarzen Überheblichkeit vor:
„Du hast gesagt: Bei deiner Liebe zu mir. Woher weißt du denn, dass Allah dich liebt.
Der entgegnet:
„Wende dich hinweg von mir, o du, dem sein Seelenheil nichts gilt! Wo war ich etwa, als Er mir die Kraft gab, Seine Einheit zu bekennen, und mich mit der Kenntnis Seines Wesens begnadete? Meinst du vielleicht, er hätte mir die Kraft dazu verliehen, wenn Er mich nicht liebte?“
So sehr das Ganze auf eine weitere Frömmelei-Geschichte hinausläuft, so ist doch dieser Punkt bemerkenswert: Ein missgestalteter schwarzer Sklave wirft Mâlik ibn Dinâr, einem direkten Jünger Mohammeds fehlendes Vertrauen in Gott vor und beschämt ihn so.
Am nächsten Tag geht Mâlik ibn Dinâr zum Sklavenhändler, um den Sklaven zu kaufen, da er von ihm begeistert ist. Der Händler überlässt ihn für zwanzig Dinare mit der Bemerkung, er sei
„ein unseliger, unbrauchbarer Bursche, der die ganze Nacht hindurch nichts anderes tut als weinen und bei Tage nichts als bereuen.“
Mâlik ibn Dinâr eröffnet ihm:
„Nur deshalb habe ich dich gekauft, damit ich selber dir diene.“
Der Sklave jammert, dass nun sein inniges Verhältnis zu Gott bloßgestellt sei und wünscht sich den Tod, der auch sofort eintritt.
„Als ich in sein Antlitz schaute, lächelte er. Da war auch die schwarze Farbe der weißen gewichen, und sein Antlitz erstrahlte und wurde hell.“
*
Die Geschichte vom frommen Manne unter den Kindern Israel
Ein Jude und seine Frau fristen ihr armes Leben mit Korbflechten. Abends zieht er los, um die geflochtenen Fächer und Tablette zu verhökern.
Da kam er bei der Tür eines der Kinder dieser Welt, eines wohlhabenden und angesehenen Mannes vorbei.
Mit "dieser Welt" ist, so muss man wohl annehmen, die muslimische Welt gemeint.
Die Bewohnerin des Hauses aber verliebt sich in ihren Mann, und da ihr Gatte nicht da ist, versucht sie, ihn mit List zu sich hereinzulocken.